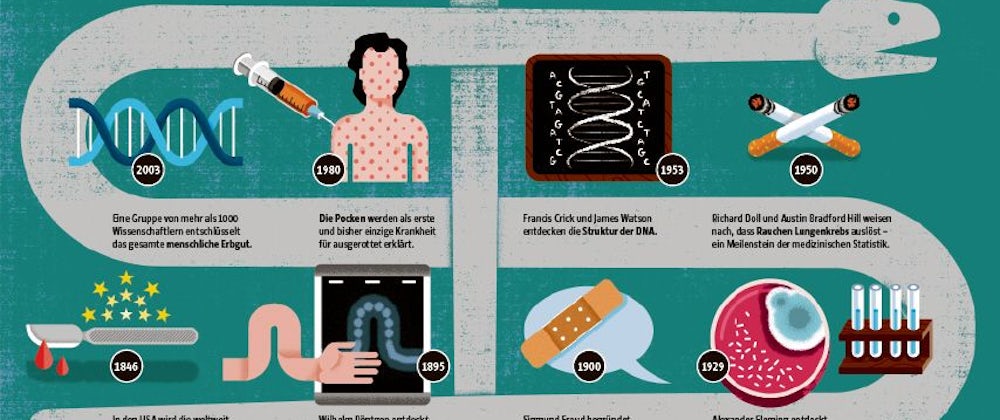"Meine Herren, das ist kein Humbug", sagte der Arzt John Warren 1846, als sein Patient vor dem versammelten Ärztekollegium die Augen aufschlug. Die Mediziner waren gerade Zeuge der weltweit ersten Narkose geworden. Der Patient hatte Ätherdämpfe eingeatmet und nicht gespürt, wie der Chirurg ihm einen Tumor aus dem Nacken entfernte. Es war ein Meilenstein auf dem Weg zur modernen Chirurgie. Von nun an blieben dem Patienten viel Pein und Panik erspart. Von nun an wurde aber auch bedingungsloses Vertrauen verlangt, denn der Kranke lieferte sich dem Arzt mehr denn je aus.
Es war die Zeit, als die Wissenschaft in die Medizin einzog, und der Arzt eine ganz neue Rolle bekam: Er war mehr als zuvor ein Wissender, ein Mann mit Macht, ein Patriarch. "Der Arzt sei bestimmt und sicher in seinen Anordnungen, er befehle, und je kürzer der Befehl, desto pünktlicher kann er befolgt werden, desto mehr Vertrauen wird der Arzt dem Patienten einflößen", hieß es 1896 in einem Ratgeber für Mediziner. Heute muss der Arzt mehrere, einander teils widersprechende Rollen ausfüllen. Er ist noch immer Wissenschaftler, aber in einer Welt, in der Wissen exponentiell wächst. Er soll ein Partner des Patienten sein und gemeinsam mit ihm die bestmögliche Lösung für seine individuelle Lage finden. Zugleich aber ist er "Leistungserbringer" in einem Gesundheitssystem, in dem wirtschaftliche Überlegungen zunehmend an Bedeutung gewinnen, sagt der Medizinethiker Professor Georg Marckmann von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (LMU).
Wie kann der Arzt den hochkomplexen Anforderungen gerecht werden? Wie wirken sich diese Forderungen auf die Patienten aus? Antworten suchten Experten auf einem Gesundheitsforum, das die Süddeutsche Zeitung gemeinsam mit der Evangelischen Akademie in Tutzing veranstaltete.
Als Anfang des 19. Jahrhunderts die ersten Medizinzeitschriften erschienen, war der Markt noch übersichtlich. Heute gibt es mehr als 20 000 Journale für Ärzte, 2014 wurden jeden Tag etwa 3250 Studien veröffentlichen, sagt Professor Markus Rehm von der Klinik für Anästhesiologie der LMU: "Kein Mensch kann das alles lesen." Um auch nur halbwegs den Überblick zu behalten, müssen sich die Mediziner spezialisieren. Es gibt 33 Fachgebiete und fast 50 Zusatz-Weiterbildungen für Ärzte - von Flugmedizin bis Handchirurgie. Begleiteten Ärzte ihre Patienten früher bei allen Leiden von der Wiege bis zur Bahre, behandeln viele Mediziner heute nur noch ein einziges Organ. Nur leider folgen die menschlichen Leiden diesen Spezialisierungen nicht.

TV-Serien beeinflussen das Bild, das sich Patienten vom Arzt machen - dank unausrottbarer Klischees. Die zehn auffälligsten von ihnen.
Gerade bei hochkomplexen Erkrankungen wie Krebs oder bei schwer zu diagnostizierenden Symptomen wie chronischen Schmerzen reicht der eine Spezialist nicht mehr aus. Also wird von ihm die Kehrtwende erwartet; er soll das große Ganze in den Blick nehmen und sich interdisziplinär vernetzen. Die mühsam errungene Spezialisierung scheint dann bedroht zu sein. Es wird um Vorrechte, mitunter auch um Macht und Ansehen gerungen, sagt Monika Dorfmüller, ehemalige leitende Psychologin der Städtischen Kliniken in München. Professor Karl-Walter Jauch, Ärztlicher Direktor des Klinikums Großhadern, weiß aus eigener Erfahrung: "Das interdisziplinäre Arbeiten kann auch dann sehr schwierig werden, wenn es um Mittelverteilung geht."

Die Ökonomisierung zwingt Kliniken zu sparen oder fragwürdige Behandlungen anzubieten. Ärzte und Pfleger sind überlastet und müssen sich immer wieder die Frage stellen: Geld oder Güte? Ihre Antwort betrifft uns alle.
Das verwundert nicht: Geld ist ein knappes Gut im Gesundheitswesen. 1977 wurde das erste Kostendämpfungsgesetz verabschiedet; ihm folgten mehr als 20 Neuregelungen, bei denen von Arzneimittelrabatten bis zu Zusatzbeiträgen von Patienten an jeder nur erdenklichen Stellschraube gedreht und weiter gespart wurde. "Schleichend kam es zu einer Dominanz der Ökonomie", sagt Professor Christoph Fuchs, ehemaliger Hauptgeschäftsführer der Bundesärztekammer. Es stellt sich die Frage, wer am Ende davon profitiert. "Mein Eindruck ist, dass sich jeder ein Stück aus dem Kuchen herausschneidet. Das funktioniert, weil das Gesundheitswesen so komplex ist, dass es kaum mehr steuerbar ist", so Fuchs.
"Die begrenzten Ressourcen sind die größte Herausforderung der Medizin", sagt der Medizinethiker Marckmann. Sie können zu ethisch bedenklichen, mitunter absurden Situationen führen. Es ist viel aufwendiger, einem Patienten zu erläutern, warum auf eine Untersuchung oder Behandlung besser verzichtet wird, als sie einfach durchzuführen, war auf dem Forum zu hören. Im Zweifelsfall wird die fragwürdige Diagnostik dann durchgezogen - vor allem, wenn lukrative Großtechnik eingesetzt werden kann. "Bezahlt wird, was nachweisbar und messbar ist. Alles, was keine Zahlen generiert, wird bedeutungslos", kritisiert Professor Andreas Eigler, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I am Klinikum Dritter Orden. Zuhören, Mitgefühl, Trost und Ermunterung gehören dazu.
Das spüren auch die Patienten: Jeder fünfte Klinikpatient versteht nicht wirklich, was der Arzt ihm sagt. Jeder zweite befindet, dass der Doktor nicht genug Zeit für ihn hat. Auch die Mehrheit der Ärzte beklagt mangelnde Zeit für die Hilfesuchenden. Das kann zu Frustration, Missverständnissen, mangelnder Kooperation der Kranken und letztlich einem schlechteren Behandlungsergebnis führen. Und der Zeitmangel kann dem Nachwuchs den Job vergällen. Die Studienmotivation schwindet schon in den ersten Semestern, die Empathie nimmt im Laufe des gesamten Studiums ab, sagt Professor Martin Fischer, Direktor des Instituts für Didaktik und Ausbildungsforschung in der Medizin am Klinikum der LMU. Die angehenden Ärzte erleben, wie demotiviert ihre älteren Kollegen sind, und befürchten, dass auch ihnen die berufliche Unzufriedenheit droht. Am Ende will ein Teil der teuer ausgebildeten Medizinstudenten gar nicht erst in die Patientenversorgung.
Dabei werden neue Ärzte gebraucht. 2013 konnten fast 60 Prozent der Kliniken offene Stellen nicht besetzen. Bis 2015 werden insgesamt etwa 41 000 Ärzte aus der Praxis oder Klinik ausscheiden, warnt Thomas Kopetsch von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Berlin.
Gleichzeitig wächst die Bevölkerung. Bis 2050 werden 9,3 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Krankheiten wie Herzinfarkt und Demenz werden sich verdoppeln. Professor Erich Reinhardt, Vorstandsvorsitzender des Forschungsverbunds Medical Valley EMN, plädierte für mehr Technik und Big Data, um diese Herausforderungen zu bewältigen - ein Ansatz, der nicht bei jedem auf Zustimmung traf.

Bald werden die Babyboomer alt. Die Forschung entwickelt sich so rasant, dass Ärzte kaum folgen können. Um die gewaltigen Herausforderungen des Gesundheitswesens zu bewältigen, müssen alle Beteiligten umdenken - auch die Patienten.
Einig waren sich die Teilnehmer des Forums am Ende vor allem darüber, dass die sprechende Medizin, also das Aufklären und Zuhören, das Trösten und Ermuntern, gestärkt werden muss. Das ist nicht einfach, denn im eng getakteten Ärztealltag muss nicht selten derjenige seine freie Zeit opfern, der einem Patienten ein offenes Ohr leiht.
Auf der anderen Seite kann ein Teil der Kommunikation auch ohne große Investitionen verbessert werden. Es ist ein Unterschied, ob der Arzt sagt "gleich zwickt es ein wenig" oder "gleich tut es weh". Ganz zu schweigen von einer Formulierung wie: "Ich bin der Anästhesist und schläfere Sie jetzt ein." 160 Jahre nach der ersten Narkose ist die Anästhesie sehr sicher geworden. Dennoch sehen die wenigsten Patienten der Narkose vollkommen gelassen entgegen. "Die Patienten sind quasi nackt, sie haben alles abgegeben - auch die Kontrolle. Ein Satz wie 'Ich passe während der Operation auf Sie auf' kann viel bewirken", sagt der Anästhesist Rehm. Denn bei aller Aufklärung und Selbstbestimmung brauchen die Patienten auch eines: Sicherheit und Schutz in ihren schwierigsten Lebenslagen.