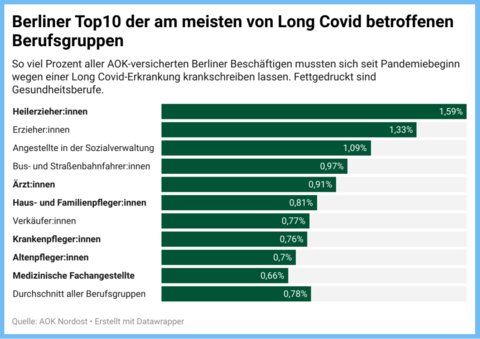„Qualität ist nicht verhandelbar”

Wie die Qualität der medizinischen Versorgung verbessert werden kann, diskutierten Experten auf dem 10. Nationalen Qualitätskongress Gesundheit in Berlin
Das deutsche Gesundheitswesen gilt gemeinhin als eines der besten der Welt. Freie Arztwahl, „kostenloser“ Zugang zum vollen Leistungsspektrum für alle Kassenpatienten, geringe Wartezeiten und eine hohe Dichte an Versorgungseinrichtungen – all das sind Dinge, um die uns andere Länder beneiden. Und doch hat Deutschland ein Problem mit der Qualität. Nicht immer und überall werden Patienten so behandelt, wie es eigentlich sein sollte. Gerade hat der soeben erschienene Qualitätsmonitor 2017 von Gesundheitsstadt Berlin und dem wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO) aufgedeckt, dass Patienten oft in der falschen Klinik landen. Falsch heißt zum Beispiel: Ein Viertel der gut 800 untersuchten Kliniken, die im Jahr 2014 Brustkrebsoperationen durchführten, behandelten weniger als acht Patientinnen im ganzen Jahr. Dabei fordern medizinische Leitlinien mindestens 50, manche sogar 150 derartige Eingriffe jährlich. Aber selbst der niedrigste Wert wird von der Hälfte der Kliniken unterschritten. Ähnlich ernüchternd sehen die Ergebnisse bei anderen Diagnosen wie etwa dem Herzinfarkt aus. Noch nicht einmal zehn Prozent der Herzinfarktpatienten kommen demnach in eine Klinik mit Herzkatheterlabor, obwohl laut Leitlinien eine Linksherzkatheteruntersuchung innerhalb von einer Stunde erfolgen sollte.
„Zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft noch eine riesige Lücke“, fasste Ulf Fink, Senator a.D. auf dem Nationalen Qualitätskongresses Gesundheit in Berlin die Ergebnisse des Reports zusammen. Deutschland sei gut beraten, mal in die USA zu schauen, meinte er. Dort habe die Einführung von qualitätsorientierten Programmen zu messbaren Verbesserungen geführt, unter anderem deshalb, weil den Kliniken bei schlechter Performance bis zu drei Prozent ihrer Vergütung abgezogen werde. „Das wirkt“, erklärte der Kongresspräsident, „und daran sollten wir uns orientieren.“
Die regionale Versorgung vergessen
Deutschland hat wie die USA kein staatliches Gesundheitswesen, vielmehr wird es von der Selbstverwaltung getragen. Mit dem vor einem Jahr eingeführten Krankenhausstrukturgesetz hat der Gesetzgeber jedoch versucht, dem stationären Bereich Qualität gewissermaßen von oben herab zu verordnen. Experten begrüßen zwar den Qualitätsgedanken ausdrücklich, bemängeln aber schwere Konstruktionsfehler des Gesetzes. Ein solcher Geburtsfehler ist nach Ansicht von Prof. Matthias Schrappe die Zementierung der sektoralen Grenzen. Qualitätsorientierte Krankenhausplanung sei gut und schön. Eine regionale Bedarfsplanung wäre besser gewesen. „Die regionale Versorgung wird durch ein Qualitätstuning des Krankenhausbereiches nicht verbessert“, kritisierte der Lehrbeauftragte für Patientensicherheit und Risikomanagement am Universitätsklinikum Köln. Weiteres Unheil sieht der Qualitätsexperte in den Qualitätsindikatoren für die Krankenhausplanung heraufziehen, die vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) bis zum 31. Dezember vorgelegt werden. Schrappes Befürchtung: Es werden inadäquate Indikatoren verwendet. Als Beispiel nannte er Qualitätsindikatoren zur Herzchirurgie. „Von den kleineren und mittleren Häusern in Ballungsgebieten, um die es hier vornehmlich geht, hat mit Sicherheit kein einziges eine Herzchirurgie“.
Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende des Verbands der Ersatzkassen (vdek), will den neuen Qualitätsindikatoren für die Krankenhausplanung dagegen eine Chance einräumen. Es sei besser, mit dem anzufangen, was man hat, als gar nicht, sagte sie.
„Mehr ging nicht“
Noch sind die Qualitätsindikatoren gar nicht veröffentlicht, da haben bereits die ersten Bundesländer angekündigt, sie nicht in ihre Krankenhausplanung einbeziehen zu wollen. Bayern etwa und Schleswig-Holstein. Die Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit (APS) Hedwig Francois-Kettner sieht darin ein weiteres Indiz dafür, dass in Deutschland jeder machen und fordern kann, was er will. Sie sei zwar gegen ein verstaatlichtes Gesundheitswesen, doch es brauche einen verbindlichen Rahmen. „Medizinische Versorgung ist eine hoheitliche Aufgabe“, sagte sie, „darum muss es eine übergeordnete Planung geben, die frei von Einzelinteressen ist.“ Auch sie kritisierte das Krankenhausstrukturgesetz. Ein Jahr nach Einführung habe sich auf den Stationen nichts an der belastenden Situation geändert. Sie erinnerte an die Streiks der Pflegekräfte, die im vergangenen Jahr für mehr Personal auf die Straße gingen. „Solange die Gegenfinanzierung nicht gesichert ist, werden alle Qualitätsbemühungen im Sande verlaufen“, betonte die APS-Vorsitzende.
Zwar sieht das Gesetz mehr Mittel für Pflegepersonal vor. Doch das erste Pflegestellenförderprogramm vor einigen Jahren habe die Kliniken extrem misstrauisch gemacht, da die Häuser nach Ablauf des Programms die zusätzlichen Stellen wieder abbauen mussten, erklärte Francois-Kettner. Dieses Misstrauen könne dazu führen, dass die Mittel gar nicht dort ankommen, wo sie eigentlich sollen.
Der Einwand ist berechtigt. Schon seit Jahren müssen Kliniken Investitionen aus ihren Betriebskosten finanzieren, da die Bundesländer ihren Investitionsverpflichtungen nicht nachkommen. Dieses Geld fehlt aktuell in der Krankenversorgung. Ein Dilemma, dem auch das Krankenhausstrukturgesetz nichts entgegenzusetzen hat. Einer, der daran mitgearbeitet hat, ist Dr. Matthias Gruhl, Leiter des Amts für Gesundheit der Hamburger Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz. Das Gesetz sei ein Kompromiss zwischen den verschiedenen Interessen der Selbstverwaltung gewesen, gab er zu. „Mehr ging nicht.“
Widersprüchliche Verflechtung von Menge und Qualität
Ein Reizwort, das die gesamt Qualitätsdiskussion durchzieht, ist das Wörtchen „Menge“. Während die einen die Mengenanreize im deutschen Gesundheitssystem kritisieren, sehen die anderen in Mindestmengenvorgaben einen weiteren Pferdefuß. Mengenvorgaben, so die Kritik, könnten zu weiteren unnötigen Eingriffen führen. Dieser Punkt ist für die im Gesetz vorgesehene Bildung von Zentren nicht unerheblich. Einerseits gilt der Grundsatz, dass Menge unmittelbar die Qualität beeinflusst, daher sollen Zentren, wo sich bestimmte Eingriffe konzentrieren, künftig mit Zuschlägen belohnt werden, wobei der Begriff „Zentrum“ bis Ende des Jahres vom G-BA noch definiert werden muss. Andererseits: Wer schützt Patienten davor, dass in grenzwertigen Fällen nicht doch einmal zu viel operiert wird, damit eine Klinik die erforderliche Fallzahl erreicht, um Zentrum zu werden oder zu bleiben? „Die Hasen rennen dorthin, wo Sie die Mohrrübe hinhängen“, sagte Dr. Frank Reibe von der Klinikum Region Hannover GmbH und konkretisierte: „Mindestmengen schaffen Anreize, die Indikationen beeinflussen werden.“
Diese Gefahr sieht auch der Direktor des Berliner IGES-Instituts Prof. Bertram Häussler. Literaturrecherchen zeigten, dass Zentren die Effizienz nicht steigern könnten. Aber: „Dort wo derzeit eine geringe Verdichtung besteht, sind Qualitätssteigerungen zu erwarten“, sagte er. Zentren, so Häusslers Schlussfolgerung, seien insgesamt eine gute Sache, so lange es nicht zu einer Monopolstellung komme. „Wir müssen aufpassen, dass im Umfeld noch Wettbewerber bleiben, sonst gehen wesentliche Anreize verloren.“
Ob Zentren auch in der Lage sind, die hohe Arbeitsverdichtung beim klinischen Personal zu verringern, ist allerdings mehr als fraglich. Schließlich werden die Zuschläge, die im kommenden Jahr eingeführt werden sollen, für allerlei Extraaufwendungen benötigt. Onkologische Zentren müssen sich beispielsweise aufwändigen Zertifizierungen unterziehen, fachübergreifende Tumorkonferenzen abhalten, Case-Manager und Psychoonkologen bereitstellen und an den Krebsregistern mitarbeiten. Für zusätzliche Stellen bleibe da nichts mehr übrig, meinten die Experten.
Arbeitsüberforderung bedeutet Qualitätseinbußen
Dabei ist die hohe Arbeitsbelastung in Kliniken das, was die Mitarbeiter unzufrieden und krank macht. Nach einer Befragung des Marburger Bunds geben 75 Prozent der Ärzte an, nicht genug Zeit für ihre Patienten zu haben. Und eine Statistik der DAK zeigt, dass das Gesundheitswesen den höchsten Krankenstand wegen psychischer Erkrankungen aufweist. „Eine chronische Arbeitsüberforderung führt definitiv zu Leistungseinschränkungen“, warnte denn auch die Psychiaterin und Ärztliche Direktorin des St. Joseph-Krankenhauses Berlin-Weißensee Dr. Iris Hauth.
Die Problematik ist seit Jahren bekannt, eine Lösung nicht in Sicht. Manch einer hofft auf die im Krankenhausstrukturgesetz vorgesehene leistungsorientierte Vergütung (Pay for Performance), wonach es künftig Zuschläge für gute und Abschläge für schlechte Leistungen geben soll. Doch erstens ist die Entwicklung entsprechender Qualitätsindikatoren äußerst langwierig und schwierig; und zweitens regt sich schon heute massiver Widerstand. Die gesetzlichen Kassen sagen klar, dass sie bei den Abschlägen nicht mitziehen werden. „Das hieße ja, dass wir schlechte Qualität finanzieren sollen“, erklärte Agnes Kübler, Referatsleiterin Finanzierung stationäre Versorgung beim vdek. „Mit den Ersatzkassen ist das nicht zu machen.“ Dem pflichtete auch AOK-Chef Martin Litsch bei, indem er sagte: „Qualität ist nicht verhandelbar.“
Unterm Strich bleibt das Krankenhausstrukturgesetz hinter den Erwartungen zurück, so das Fazit auf dem Nationalen Qualitätskongress Gesundheit, und es sei äußerst zweifelhaft, ob das Qualitätsversprechen eingelöst werden könne.
Krankenhaus – ein Ort der Bedrohung?
Der Arzt und Kabarettist Dr. Eckart von Hirschhausen glaubt unterdessen weder an neue Gesetze noch an Qualitätsindikatoren oder andere zahlenlastige Papiertiger. In seinem Vortrag „Warum mit der Stimmung auch die Qualität kippt“, beklagte er, dass im Gesundheitswesen die Emotion und der Humor verlorengegangen seien. Patienten brauchten Zuwendung und seien keine Renditeobjekte, erklärte er. „Wenn heute jeder vierte Arzt vor seiner eigenen Klinik warnt, ist das ein weiteres Zeichen dafür, dass Krankenhäuser nicht mehr als Orte der Rettung, sondern als Orte der Bedrohung wahrgenommen werden.“ Dass Klinik-Clowns daran etwas ändern können, hat seine Stiftung „Humor hilft heilen“ mittlerweile mit mehreren Studien belegen können. Eine Pilotstudie der Kinderchirurgie am Universitätsklinikum Greifswald zeigt zum Beispiel, dass neben der erfragten Patientenzufriedenheit auch ein objektiv messbarer Indikator steigt: der Spiegel des Wohlfühlhormons Oxytocin.
Mit seiner humorvoll verpackten, aber in der Sache ernsten Kritik hat Hirschhausen den Finger in eine tiefe Wunde des Gesundheitssystems gelegt. Doch es gibt noch andere wunde Punkte, etwa die vielen Krankenhausinfektionen. Allein auf deutschen Intensivstationen treten jedes Jahr 88.000 solcher Fälle auf. Abgesehen von dem damit verbunden Leid müssen die Kassen den Kliniken dafür jedes Jahr 590 Millionen Euro überweisen – zusätzlich zu den DRGs. Hedwig Francois-Kettner würde den Kliniken diese Vergütung am liebsten streichen und das Geld in mehr Pflegepersonal investieren. „Das ist nur ein Beispiel, wie man aus dem Desaster der kaputt gesparten Pflege wieder herauskommen könnte“, sagte sie, und kritisierte die Selbstverwaltung, diesen Zustand selbst herbeigeführt zu haben.
Den Finger in die Wunden legen
Der Nationale Qualitätskongress Gesundheit schaut seit elf Jahren dem System genau auf die Finger und nennt die Dinge beim Namen. Seither hat sich der Qualitätsgedanke mehr und mehr verbreitet und zu diversen Qualitätsoffensiven geführt. Doch ein 300 Milliarden Euro schweres System krempelt man nicht von heute auf morgen um. Deshalb wird der Kongress auch im nächsten Jahr wieder Schwachstellen aufzeigen und Lösungsoptionen erarbeiten, um das Gesundheitssystem, wie Kongresspräsident Fink sagt, ein kleines Stück besser zu machen.
Foto: Gesundheitsstadt Berlin