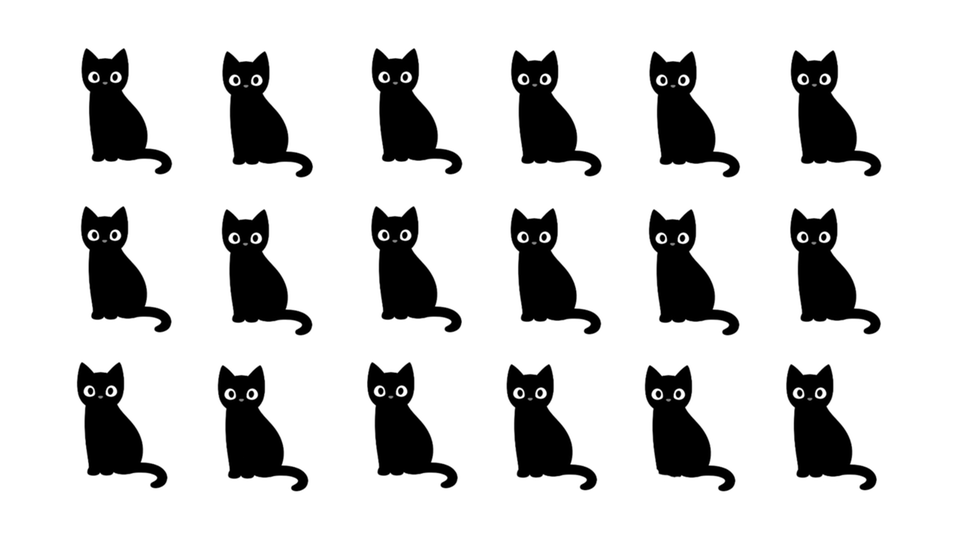Niemand entkommt dem Krankenhaus. Die meisten von uns verbringen ihre ersten Lebenstage dort, sehr viele ihre letzten Wochen und Monate. Dazwischen liegen Jahrzehnte, in denen wir immer wieder auf die Kliniken angewiesen sind – wegen Kreuzbandriss, Schlaganfall, Krebs. Oder zumindest darauf vertrauen müssen, dass sie im Notfall da sind, um zu helfen. Wir alle hoffen, im Krankenhaus Heilung und Linderung zu finden.
Diese Hoffnung wird zu oft enttäuscht. Patienten und Angehörige spüren, wenn sie Ärzte, Schwestern und Pfleger an sich vorbeihasten sehen, dass an diesem Ort der Einzelne mit seinen Beschwerden und Ängsten wenig zählt. Immer wieder erschütterten vermeidbare Skandale das Vertrauen: die Ausbrüche multiresistenter Keime, die Manipulationen bei Wartelisten für Organspende-Empfänger. Oder die Berichte Angehöriger über die teils qualvolle lebensverlängernde Behandlung von Sterbenden, die eher dem Gewinn dient als dem Wohl des Todgeweihten.
Einzelfälle, hofft man. Dort, wo man selbst sich Ärzten anvertrauen muss, ist es anders. Oder nicht?

Es ist mittlerweile das ganze System, das krank ist. So leistet sich Deutschland zwar eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt, neueste Therapien sind verfügbar, und doch sterben wir im Durchschnitt früher als die Menschen in vielen vergleichbaren Ländern. Griechenland gibt nicht einmal halb so viel Geld pro Einwohner für Gesundheit aus, aber die Lebenserwartung ist selbst dort höher. Unser Kliniksektor bietet Beschäftigung, Hightech und Profite. Doch bei seinem eigentlichen Produkt – der Gesundheit – bleibt er unter den Erwartungen. Warum?
Weshalb etwa werden in Deutschland so viele Patienten wegen Hüft-, Knie- oder Rückenbeschwerden unnötigerweise operiert, während zugleich chronisch kranke Kinder und Alte, die dringend Hilfe brauchen, heute nicht selten bereits in den Notaufnahmen abgewiesen werden? Fast nirgends auf der Welt arbeiten derart viele und so gut ausgebildete Ärzte und Pflegekräfte. Dennoch fehlt die Zeit für Gespräche mit den Patienten.
Warum?
Der stern hat mit mehr als 100 Medizinern aus ganz Deutschland gesprochen, um Antworten zu finden – mit Assistenzärztinnen, Klinikdirektoren, Präsidentinnen von Fachgesellschaften und von Ärztekammern, mit Ethikern. Viele erleben dramatische Missstände, sieben Augenzeugenberichte sind hier dokumentiert, weitere folgen online auf stern.de. In den Gesprächen wirkten die Ärzte getrieben von der ständigen Sorge, dass sie die Sicherheit ihrer Patienten nur mit Mühe, wenn überhaupt noch, gewährleisten können. Aus diesen Gesprächen, in denen so viele die gleichen Missstände beklagten, entstand die Idee des Ärzte-Appells. Bei Erscheinen des Ärzte-Appell-Titels am 5. September hatte er 215 Unterzeichner, viele bedeutende Organisationen schlossen sich ihm an. Seitdem wächst die Zahl der Unterstützer. Die Liste mit den unterzeichnenden Ärzten finden Sie hier - sie wird fortlaufend aktualisiert.
Der Schritt an die Öffentlichkeit fällt vielen Medizinern nicht leicht, denn er ist riskant. Die Oberärztin Silvia Vieker etwa verlor 2018 ihre Anstellung am Klinikum Bayreuth, nachdem sie öffentlich auf Probleme mit falschen Diagnosen und Therapien in der Kinderneurologie hingewiesen hatte, die aus ihrer Sicht bestanden (stern Nr. 43/2018). Vieker sagt: "Man kann auch heute noch in Krankenhäusern problemlos sein Brot verdienen, aber nur unter drei Grundvoraussetzungen: Seid blind, taub und stumm."
Der pauschalengerechte Patient
Fast alle vom stern befragten Ärztinnen und Ärzte nannten zwei Ursachen für die Misere: extremen ökonomischen Druck und das vor 16 Jahren eingeführte (und in seiner Radikalität international einzigartige) Abrechnungssystem nach "Fallpauschalen". Für diese "DRGs" (Diagnosis Related Groups) werden Diagnosen in "Fallgruppen" gruppiert und pauschal vergütet – nach der Faustregel: Je höher der Aufwand, desto mehr Geld. Der fatale Effekt: Patienten rechnen sich – egal, wie krank sie sind – in diesem System vor allem, wenn an ihnen viele "Prozeduren" durchgeführt werden. In der DRG-Logik sind das alle Eingriffe von einer Spritze über Magenspiegelungen bis hin zu großen Operationen.
Wer im Krankenhaus Hilfe sucht, erfährt gewöhnlich nicht, wie die Abrechnungsmechanismen des DRG-Systems sich zu seinem Nachteil auswirken können. Jan Walz* war einfach froh, von seinen Schmerzen erlöst zu sein. In einer Hamburger Notaufnahme hatten Ärzte Harnsteine entdeckt und ihm eine Schiene in den Harnleiter geschoben, um diesen langsam zu weiten. Zwei Monate später solle Walz wiederkommen, dann werde der Stein mit Stoßwellen zertrümmert und entfernt.
Das wochenlange Leben mit der Schiene war schlimm. "Bei jeder unbedachten Bewegung hatte ich Schmerzen und Harndrang, immer wieder war Blut im Urin", sagt Walz. Heute weiß er, dass er sich maximal 14 Tage hätte plagen müssen. In unkomplizierten Fällen gibt es keinen medizinischen Grund, die Schiene länger im Körper zu lassen. Aber einen wirtschaftlichen: Ab Tag 31 gab es für seinen Fall etwa 1400 Euro mehr.
Es ist ein harmloses Beispiel für das Übergreifen marktwirtschaftlicher Interessen auf einen der schützenswertesten Bereiche unseres Lebens. In den schlimmen Fällen geht es darum, ob Menschen ihr weiteres Leben selbstständig oder behindert verbringen, ob sie weiterleben dürfen oder sterben dürfen – oder müssen. So wie womöglich im Fall der 71-jährigen Angela S.* Bis heute fragt sich ihre Familie, warum die Krebspatientin im Endstadium noch so lange leiden musste. Technisch gesehen lag es an der künstlichen Beatmung, die sie selbst wohl nie gewollt hätte. Ein Intensivmediziner hatte ihr den dazu nötigen Tubus in die Luftröhre geschoben, obwohl bereits ein Schlaganfall, Arterienverschlüsse in beiden Beinen und eine Lungenentzündung die Todkranke weiter geschwächt hatten. Weil seine Mutter kaum zu Bewusstsein kam, sprach der bevollmächtigte Sohn für sie. Er sagte: keine lebenserhaltenden Maßnahmen. Doch Angela S. starb erst vier Monate später – nach elf weiteren Operationen. Massive Fehlanreize im Abrechnungssystem seien es, die solche Entscheidungen beeinflussten, sagt der Palliativmediziner Matthias Thöns, der den Fall gut kennt: Ein Tag Beatmung bringt einem Krankenhaus bei Schwerkranken aktuell 25.495 Euro, vier Tage schlagen mit 58.215 Euro zu Buche. Für Angela S. wurde im Jahr 2017 die Langzeitbeatmungspauschale "A06A" abgerechnet: Damals waren das 207.648 Euro.
Gerade wenn Komplikationen einen Fall weniger profitabel machen, kann die lukrative Beatmung die Bilanz retten. Dabei können Langzeitbeatmungen selbst viele Komplikationen verursachen: Lungenschäden, eine Muskel-Nervenkrankheit oder ein oft tödliches Gallenleiden. Natürlich wäre es auch denkbar, dass der Arzt, der den Beatmungstubus einschob, seine Patientin einfach nicht aufgeben wollte. Ökonomisch gesteuerte Entscheidungen spielen sich sehr oft in einem Graubereich ab, in dem Ärzte aus medizinischen Erwägungen so oder anders handeln könnten. Die Statistiken allerdings lassen den sicheren Schluss zu, dass sie hochwirksam sind.
Das große Geld
Woher kommt der Druck? In den 1990er Jahren nahm die Ökonomisierung der Medizin Fahrt auf. Politiker fürchteten damals eine "Kostenexplosion" im Gesundheitswesen. Und tatsächlich herrschte Misswirtschaft auf Kosten der Beitragszahler. Krankenhäuser bekamen Festbeträge für jeden Tag, den Patienten dort verbrachten – egal, wie krank sie waren. Man behielt sie gern lange da, besonders übers Wochenende. Das DRG-System sollte Patienten davor schützen: Es sollte Transparenz bringen, die Kassenbeiträge stabil halten und obendrein die im internationalen Vergleich zu vielen Krankenhäuser in einen Verdrängungswettbewerb zwingen. "Nichts funktioniert besser als der freie Markt" – dem neoliberalen Glaubensbekenntnis huldigten Politiker quer durch die Parteien. So bereitete CSU-Gesundheitsminister Horst Seehofer die Einführung der Fallpauschalen vor, die Grüne Andrea Fischer vollzog sie, die SPD-Frau Ulla Schmidt zementierte sie. Im Mikrokosmos vieler Krankenhäuser zeigt sich die Entwicklung heute daran, dass kaufmännische Direktoren den ärztlichen vorgesetzt sind. Ökonomen aber sind nicht dem ärztlichen Ethos verpflichtet. Ihr Erfolg, so will es das System, bemisst sich an Zahlen. Es ist nicht Niedertracht, sondern bloß natürlich, dass Ökonomen den DRG-Katalog exakt so lesen wie Steuerbestimmungen – mit dem Ziel, sie so auszulegen, dass ihr Unternehmen viel verdient.
Und so müssen immer mehr "Fälle" in gleicher Zeit behandelt werden. Je mehr, desto mehr Erlös. Seit der Einführung der Pauschalen steigt die Zahl der Krankenbehandlungen stetig, es ist eine europaweit einzigartige Entwicklung. So kommt es, dass in Deutschland zwar mehr Ärzte arbeiten als in vergleichbaren Ländern. Sie haben jedoch pro "Fall" am wenigsten Zeit. Dieses knappe Gut sollen sie tunlichst nicht für ertragsschwache Gespräche mit Patienten vergeuden. Auch das oft richtige Abwarten und Nachdenken über die beste Therapie ist nach dieser Logik verlorene Zeit: Belohnt wird im DRG-System Aktionismus. 40.000 Prozeduren nennt der Leistungskatalog, sie werden auf komplizierte Weise zu einer Gesamtvergütung verrechnet, in die auch Faktoren wie Diagnose, Erkrankungsschwere oder Alter einfließen. Kaum ein Arzt versteht noch, wie genau. Wenn eine Prozedur erledigt ist, muss sie sogleich dokumentiert werden. Ein neuer Beruf ist bald nach der Einführung des DRG-Systems entstanden: "Kodierer" fahnden im gewaltigen Prozeduren-Katalog nach jeder Ziffer, die sich abrechnen lässt. Nur nichts übersehen, keinen Cent zu wenig abrechnen. Auch der im Ringen um das Geld natürliche Widersacher der Krankenhauskodierer, der Medizinische Dienst der Krankenkassen, rüstet sich mit solchen Spezialisten hoch, es werden immer mehr. Gegenseitig schaffen sie einander Arbeit, wie die Steuerbeamtin dem Steuerberater.
Subtile Zwänge
Mit Zuckerbrot und Peitsche machen sich in dieser Kampfzone Geschäftsführer ihre Mediziner gefügig. Mit weitverbreiteten Bonusverträgen korrumpieren sie Ärzte, vor allem solche in leitenden Positionen: Je mehr lukrative Patienten diese heranschaffen, umso höher werden ihre Sonderzahlungen. Tumorkranke etwa sind lohnend. So kommt es, dass selbst in Zeiten großer Fortschritte der Krebstherapie immer noch viele Erkrankte nicht in von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierte Zentren kommen, sondern in Provinzkliniken, wo die Ärzte kaum Routine mit den ausgefeilten Operationsverfahren und Behandlungsschemata haben. Es kann sie im Extremfall Lebensjahre kosten. Auch subtile Erpressung wirkt: Liefern Chefärzte nicht, werden ihren Abteilungen Stellen gestrichen. "Dann haben alle im Team Angst, noch mehr arbeiten zu müssen, und denken darüber nach, wie man Erlöse erzielen kann" , sagt Justus Hilpert, der früher eine Intensivstation leitete.
"Die ökonomische Logik höhlt in diesem System die ärztliche Logik aus", resümiert der Freiburger Medizinethiker Giovanni Maio. Belohnt werde nicht der sorgfältige, sondern der stromlinienförmige Arzt, der fließbandartig vorgehe. "Der Arzt lernt, Patienten schon bei der Notaufnahme nicht nur nach dem medizinischen Bedarf zu klassifizieren, sondern ob sie Gewinn versprechen." Das Perfide sei: Niemand schreibe ausdrücklich vor, so zu denken. "Der Arzt selbst meint, sich diese Vorschrift machen zu müssen." Maio geißelt das als "ideelle Verformung der Ärzte".
Wie oft Ärzte "verformt" werden, weiß kaum jemand so genau wie der Bremer Ethiker und Arzt Karl-Heinz Wehkamp. Er hat es erforscht, gemeinsam mit einem ehemaligen Klinik-Geschäftsführer. Die beiden reisten durch Deutschland und fragten Dutzende Ärzte und Geschäftsführer anonym, wie oft betriebswirtschaftliche Vorgaben ärztliche Entscheidungen beeinflussen. "Die Geschäftsführer stritten solche Einflüsse ab, wohingegen fast alle Ärzte sie spürten. Viele sprachen von "durchgängig", "täglich" bei "jeder Visite" oder "immer mehr"", sagt Wehkamp. "Nicht wenige leiden darunter und versuchen sich zu wehren, doch es geht eben nicht immer." So berichteten zwei Drittel der Befragten von Operationen ohne echte Notwendigkeit, fragwürdigen Herzkathetermaßnahmen, Darmspiegelungen und verlängerten künstlichen Beatmungen. Die Mehrheit der Ärzte gab an, Patienten aufgenommen zu haben, die "nicht unbedingt ins Krankenhaus gehören", um mehr "Fälle" zu bekommen.
Denn je mehr Fälle, desto sicherer das Überleben der Klinik. "Es gab eine heimliche Agenda hinter der Einführung der Fallpauschalen", resümiert Günther Jonitz, Präsident der Ärztekammer Berlin, der das DRG-System stets bekämpft hat. "Weil sich kein Lokalpolitiker traut, die kleine Klinik vor der eigenen Haustür zu schließen, sollte es der Wettbewerb richten." Der Wettbewerb – ein gesichtsloser Götze, unter dessen Ägide sich der unrentabel Arbeitende selbst beseitigt.
Tatsächlich treiben die Bundesländer Kliniken in die roten Zahlen, indem sie ihnen seit Jahren Geld für Investitionen vorenthalten. In Deutschland, ein weiterer nationaler Sonderweg, sind die Länder für Baumaßnahmen und die Anschaffung etwa von medizinischen Geräten zuständig, die Kassen hingegen für sämtliche Kosten rund um die Patientenversorgung. Aufgrund der staatlichen Schmalhanserei finanzieren die Krankenhäuser heute jedoch vielfach ihre Infrastruktur-Investitionen aus den Fallpauschalen – systemwidrig. Dafür sparen sie Personal, für dessen Gehälter die Pauschalen gedacht sind. Mehr als ein Drittel der Kliniken liegt heute in der Hand von privaten Trägern – diese finanzieren aus den Fallpauschalen zusätzlich noch die Renditeerwartungen der Anteilseigner.
Die Unterstützer des Ärzte-Appells sind sich einig: So darf es nicht weitergehen. Ein Notstopp muss her. Längst formieren sich die Mediziner zum konzertierten Widerstand, vorneweg die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin mit einem Ärzte-Kodex "Medizin vor Ökonomie", hinter dem sich 30 Organisationen scharen. Dieser Kodex und andere Stellungnahmen hochrangiger Institutionen waren Vorlage für den Ärzte-Appell. Der Kodex ruft Ärzte dazu auf, sich wirtschaftlichen Zielvorgaben zu widersetzen, wenn diese das Patientenwohl verletzen. Ein machtvoller Auftritt – doch es ist fraglich, ob die Ärzte noch genug Macht haben, um das System von innen heraus zu verändern. Der Berliner Gesundheitsökonom Alexander Geissler denkt weiter. "Kliniken müssten unabhängig von Fallpauschalen Sockelbeträge bekommen für all das, was bisher schlecht im Abrechnungssystem abgebildet ist." Profitieren würden einerseits große Krankenhäuser, wenn sie viele schwere, bislang schlecht honorierte Fälle und Patienten mit seltenen Erkrankungen versorgen. Und das kleine Kreiskrankenhaus, das für eine unterversorgte Region überlebenswichtig ist, "hätte dann weniger Druck, Krankenhausfälle zu generieren und Erlöse über die Behandlung hochkomplexer Fälle zu erzielen, für die es gar nicht geeignet ist".
Knapp 2000 Kliniken gibt es in Deutschland – auf die Einwohnerzahl bezogen international ein Spitzenwert. Etwa 800 bis 1000 seien überflüssig, so Schätzungen, über die derzeit viel gestritten wird. Wo heute drei kleine Krankenhäuser dicht an dicht um Patienten konkurrieren, könne man schließlich ein größeres Zentrum bauen, das frei werdende Personal würde dort dringend gebraucht. Doch eine solche Strategie fordert einen langen Atem – und Bereitschaft zu Investitionen. Als Vorbild gilt Dänemark: Dort entwickelte man in den frühen 2000er Jahren einen Masterplan, neue Kliniken wurden gebaut, wo vorher keine waren, der Rettungsdienst wurde neu aufgestellt, die Erstversorgung anders organisiert. Ergebnis: Heute reichen den Dänen 25 große Krankenhäuser. In Deutschland gibt es keinen derartigen Plan, die Krankenhauslandschaft ist über Jahrzehnte wild gewachsen. Und was würde passieren, wenn Politiker jetzt dem lauten Ruf nach Krankenhausschließungen folgen würden, ohne sich zugleich um die Fehlanreize zu kümmern? Es gäbe sie dann weiter, nur mit weniger Kliniken. Das wäre fatal.
Für den Berliner Ärztekammerpräsidenten Günther Jonitz ist klar: "Man muss das Gesundheitswesen ganz neu denken und dem hohen ökonomischen Druck ein Ende bereiten." Ein Vorbild, das Jonitz vorschwebt, existiert in Deutschland schon seit dem Jahr 1884: Es ist das System der Berufsgenossenschaften – die gesetzliche Unfallversicherung. Anders als die Krankenkassen orientiert sie ihre Zahlungen nicht daran, welche Kosten für Medikamente, Personal, Krankenhäuser und Arztpraxen entstehen, sondern daran, wie schnell die Patienten wieder auf die Beine kommen. Weil der Arbeitsfähigkeit des einzelnen Unfallopfers seit bald eineinhalb Jahrhunderten ein solch hoher Wert beigemessen wird, ist sie "mit allen geeigneten Mitteln" herzustellen, heißt es im Sozialgesetzbuch VII. Ganz anders klingt hingegen eine zentrale Passage in seinem Schwestergesetz, dem Sozialgesetzbuch V, das den Alltag der "gewöhnlichen" Krankenhäuser bestimmt. Sie lautet: "Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein; sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten." Der Alltag spiegelt es wider: "Alles kommt aus einer Hand, alle arbeiten an einem Ziel", preist Ärztekammerpräsident Jonitz die berufsgenossenschaftlichen Versorgungsstrukturen.
Vielleicht käme man mit so einem System einem Ideal näher, in dem nicht mehr Fehlanreize und Profitgier die Krankenversorgung dominieren, sondern nur noch ein Ziel: der gesunde Patient.
*Namen von der Redaktion geändert
Hier berichten Ärztinnen und Ärzte über den ökonomischen Druck, dem sie in Kliniken ausgesetzt sind:
- Dr. med. Elsbeth Fischer* klagt über enormen Zeitdruck und berichtet von einem unnötigen Eingriff, den ihr Oberarzt durchsetzte.
- Dr. med. Arndt Dohmen spricht über den "fatalen Anreiz", Amputationen durchzuführen, weil diese sich mehr rechnen als eine konservative Therapie.
- Dr. med. Maike Manz erzählt, welche falschen Anreize die Anzahl von Kaiserschnitten stark steigen lassen und welche Folgen das mit sich bringt.
- Prof. Dr. med. Ingeborg Krägeloh-Mann sagt: "Nur die Diagnose wird betrachtet, nicht der Patient in seiner Gesamtsituation."
- Mehr Eingriffe, weniger Patientenwohl: Prof. Dr. med. Achim Schneider prangert wirtschaftlichen Druck in Kliniken an.
- Dr. med. Günther Jonitz wittert im Fallpauschalen-System "eine Gratwanderung an der Grenze zum Betrug".
- Dr. med. Justus Hilpert musste während seiner Zeit im Krankenhaus feststellen, dass die Dauer von Beatmungen nicht immer im Sinne der Patienten festgelegt wird.
Wer kann den Ärzte-Appell unterstützen?
Alle Bürgerinnen und Bürger. Für sie hat der Rheuma-Patient Ludwig Hammel eine Online-Petition gestartet, zu finden unter www.change.org/menschvorprofit.
Alle Organisationen, Gesellschaften, Verbände und Vereine, die im Gesundheitssektor aktiv sind und den Ärzteappell geschlossen unterstützen wollen. Schicken Sie eine Mail an aerzteappell@stern.de
Ärztinnen und Ärzte können den Appell namentlich unterstützen. Schreiben Sie bitte an aerzteappell@stern.de. Die Liste der Unterzeichner wird auf stern.de veröffentlicht. Um überprüfen zu können, dass Sie wirklich Ärztin oder Arzt sind, benötigen wir von Ihnen folgende Angaben (nur Punkt 1-3 wird veröffentlicht):
1. den vollständigen Namen
2. Facharztbezeichnung und Funktion
3. Arbeitsort
4. Arbeitgeber
5. E-mail von einem verifizierbaren Account (z.B. Ihre Praxis, Ihr Arbeitgeber)
6. Hilfreich: Website-Auftritt Ihrer Praxis oder Ihres Arbeitsgebers mit Angaben zu Ihnen
Sollten Sie Beispiele beobachten, die zeigen, wie wirtschaftliche Zwänge ärztliche Entscheidungen beeinflussen, schreiben Sie uns gern auch dies. Wir nehmen dann vertraulich Kontakt zu Ihnen auf.