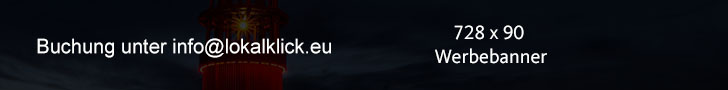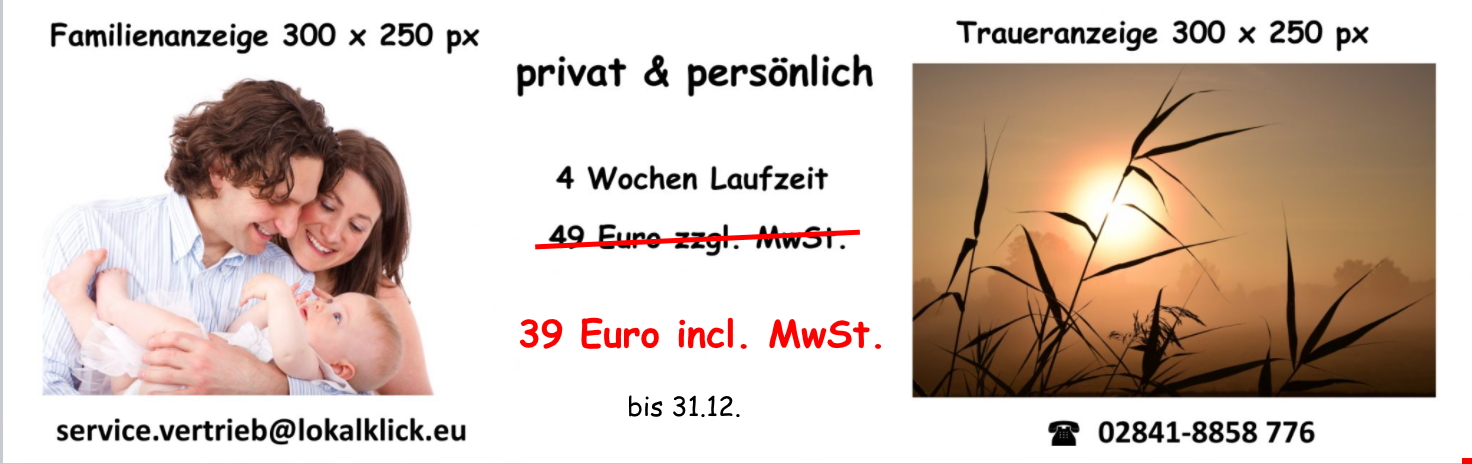Geldern. Priv.-Doz. Dr. med. Dalibor Bockelmann unterstützt die Betriebsleitung bei der strategischen Weiterentwicklung.
Seit Februar arbeitet Priv.-Doz. Dr. med. Dalibor Bockelmann in und mit der Betriebsleitung im St.-Clemens-Hospital. Der 49-Jährige ist Viszeralchirurg mit MBA-Abschluss im Fach „Management in der Medizin“. Mit dieser Doppelqualifikation agiert er als Schnittstelle zwischen Verwaltung, Pflege und Ärzteschaft. Der Ärztliche Leiter des Medizinischen Managements ist mitverantwortlich für die strategische Weiterentwicklung und langfristige Standortsicherung des Gesundheitscampus St.-Clemens.
Guten Tag Herr Dr. Bockelmann. Wie geht es dem St.-Clemens-Hospital in der aktuellen Situation?
Uns geht es wie fast allen bundesdeutschen Krankenhäusern: Wir tragen eine hohe Verantwortung in der Versorgung von Covid-19-Erkrankten auf der Intensiv- und Isolierstation einerseits, andererseits stellen wir den Routinebetrieb mit maximaler Sicherheit für alle Patienten sicher. Das ist mit einer erheblichen Mehrbelastung für die Mitarbeitenden und das Haus verbunden, beispielsweise durch spezielle Materialbeschaffung oder die Notwendigkeit von Covid-Testungen. Diesem Maximaldruck sind wir nun seit mehr als einem Jahr ausgesetzt, und ich empfinde großen Respekt und eine tiefe Dankbarkeit dafür, wie sich das medizinische Personal seit Monaten dagegenstemmt. Aktuell beobachten wir, dass unsere Covid-Patienten deutlich jünger sind als zu Beginn der Pandemie. Sowohl unsere Intensiv- als auch die Isolierstation arbeiten an der Belastungsgrenze. Gleiches gilt für das gesamte pflegerische und ärztliche Personal. So ist die Situation bei uns und in den meisten anderen Kliniken.
Aus Sicht des Medizinmanagements hat die Pandemie noch eine andere Seite: Die Krise legt schonungslos offen, wo die Stärken und Schwächen unseres Systems liegen – und schon vor Corona lagen. Das birgt eine große Chance: Wir können die teilweise sehr schmerzhaften Erkenntnisse mitnehmen und in die Zukunftsplanungen am eigenen Standort und in die weitere Ausgestaltung des Gesundheitssystems einfließen lassen.
Worin genau liegen denn die Schwächen des Systems?
Gestatten Sie mir eine kurze Vorbemerkung: Das Gesundheitssystem leistet trotz vieler Herausforderungen, wie den Fachkräftemangel, exzellente Arbeit und hat nicht erst in den letzten 12 Monaten seine Leistungsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Bezüglich der Schwächen fallen mir als erstes die Schlagworte „Krankenhausfinanzierung“ und „Vergütungssystem“ ein. Diese Aspekte beschäftigen uns in der täglichen Praxis sehr, weil wir auf Liquidität angewiesen sind und unsere eigenen Arbeitsprozesse entsprechend ausrichten müssen.
Wie funktionieren Krankenhausfinanzierung und Vergütungssystem?
Vereinfacht gesagt haben wir in Deutschland eine duale Finanzierung der Krankenhäuser. Die jeweiligen Bundesländer sind für Investitionsmittel zuständig, z. B. für Neubau- oder Renovierungsmaßnahmen. Jedes Bundesland handhabt die Vergabe der Mittel unterschiedlich. Allen gemein ist jedoch, dass die Länder ihren Verpflichtungen seit Jahren nicht vollumfänglich nachkommen. Projekte wie den Neubau unseres Bettenhauses müssen wir deshalb zu einem nicht unerheblichen Teil aus Eigenmitteln realisieren.
Die andere Schiene der dualen Finanzierung sind die sogenannten Fallpauschalen oder „DRGs“. Über sie sollen die laufenden Betriebskosten abgedeckt werden, unter anderem Gehälter, Heizung, Material, aber auch Vorhaltekosten, beispielsweise um den OP jederzeit einsatzbereit zu halten.
Die Abrechnung dieser Fallpauschalen ist aus Krankenhaussicht ein problematischer Punkt: Denn es ist keineswegs so, dass erbrachte Leistungen auch vollständig bezahlt werden.
Dieses Fallpauschalensystem scheint sich zunehmend um sich selbst zu drehen – eine Entwicklung, die ich mit einer gewissen Sorge beobachte. Der Abrechnungsprozess erfordert von allen Beteiligten – Krankenhäuser, Krankenkassen und Medizinischer Dienst – erhebliche Ressourcen für den Austausch untereinander. Spätestens dann, wenn wir über eine Rechnungskürzung aufgrund eines fehlenden Handzeichens im Protokoll einer Teamsitzung diskutieren, haben wir ein Niveau erreicht, auf dem man sich nicht begegnen sollte. Das ist sicher ein extremes, aber leider auch reales Beispiel. Ich jedenfalls würde mir die Zusammenarbeit mit den Kostenträgern zuweilen deutlich partnerschaftlicher wünschen.
Hat sich das bestehende Fallpauschalensystem denn während der Pandemie bewährt?
Das Fallpauschalen- oder DRG-System ist nicht dafür gedacht, sich während einer Pandemie zu bewähren. Konkret sehen wir, dass viele Krankenhäuser unter den aktuellen Bedingungen, insbesondere in Bezug auf die Vorhaltekosten, eine Unterdeckung verbuchen.
Können Sie das näher erläutern?
Es kommen an diesem Punkt verschiedene, für Krankenhäuser ungünstige Faktoren zusammen. Seit 2016/17 stagnieren in der Bundesrepublik die stationären Fallzahlen, während die Kosten, u. a. für Energie, Material oder Personal, steigen. Hier ist eine erste Schere aufgegangen. In der Corona-Zeit driften Kosten und Erlöse noch weiter auseinander. Die Betreuung der Covid-19-Patienten ist besonders personal- und materialintensiv, d. h., dass wir Personal von anderen Stationen abziehen und in die Versorgung der Covid-Patienten umschichten müssen. Gleichzeitig verzeichnen die meisten Krankenhäuser einen deutlichen Rückgang der Patientenzahlen für die „normalen“ Betten. Im Rahmen der ersten Welle im Frühjahr 2020 wurden planbare Behandlungen abgesagt und verschoben, um Platz für die erwarteten Covid-Patienten zu schaffen. Nach dem Ende der Maßnahme im Frühsommer trat eine überraschende Beobachtung ein: Die Patientenzahlen stiegen nicht mehr auf das ursprüngliche Niveau. Hier ging eine zweite Schere auf.
Wir sehen an diesem Punkt, dass das DRG-System dafür gemacht ist, stationäre Leistungen zu vergüten und nicht, um Betten für Eventualitäten freizuhalten. Auch wenn es Kompensationen durch den sogenannten „Rettungsschirm“ gibt, leiden viele Krankenhäuser unter Liquiditätsproblemen, die in anderen Regionen schon zu Schließungen geführt haben. Knackpunkt sind dabei insbesondere die Vorhaltekosten für spezifische Infrastruktur eines Krankenhauses, die durch die Freihaltepauschale nicht ausreichend gegenfinanziert werden.
Das DRG-System muss also reformiert werden?
Ja, ich glaube schon, dass es perspektivisch einer gründlichen Überarbeitung bedarf. Ich höre vereinzelt den Wunsch nach einer kompletten Abkehr vom Fallpauschalensystem und nach Rückkehr zur vermeintlich guten, alten Zeit. Doch die romantische Verklärung der Vergangenheit hilft uns an dieser Stelle nicht weiter – das alte System wurde aus meiner Sicht berechtigt ersetzt. Meine persönliche Mindestanforderung an das Vergütungssystem ist, dass es einem Krankenhaus möglich sein sollte, auskömmlich zu arbeiten. Dabei müssen auch regionale Besonderheiten eine Rolle spielen, denn im ländlichen Raum übernehmen wir eine andere Rolle in der medizinischen Grundversorgung als Krankenhäuser in Berlin oder München. Ein regionales Budget könnte sicherstellen, dass wir dieser Aufgabe dauerhaft gerecht werden. Ein anderer Weg könnten sogenannte „Hybrid-DRGs“ sein, über die wir ambulante Leistungen kostendeckend anbieten könnten. Sicher ist, dass wir uns als Krankenhaus in Zukunft verstärkt an unserer Qualität messen lassen müssen. Alleine hieraus erwachsen strategische Überlegungen, wie man das alles als einzelner Standort abbilden möchte. Hier benötigen wir neue Denkansätze, wie intersektorale Partnerschaften oder Kooperationen zwischen Standorten aussehen könnten.
Aber es gibt doch schon gute Ansätze zur Reform der Krankenhausfinanzierung, zum Beispiel das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz.
Ein wesentliches Ziel dieses Gesetzes ist es, mehr Pflegende einzustellen. Doch jetzt zeigt sich, was schon vorher jedem bewusst war: der Markt für Pflegekräfte ist leer. Oder anders ausgedrückt: Weil eine Pflegekraft mittlerweile refinanziert wir, gibt es dennoch keine, die ich einstellen kann. Der Fachkräftemangel macht uns sehr zu schaffen. Auf der anderen Seite gilt es, Pflegepersonaluntergrenzen in bestimmten Bereichen einzuhalten – Sie sehen, dass sich die Katze an dieser Stelle in den Schwanz beißt.
Wir bemühen uns natürlich nach Kräften, unser Pflegeteam weiter aufzustocken. Im Vergleich mit vielen Wettbewerbern stehen wir sogar noch ganz gut da, dennoch ist die Personaldecke dünn – in der aktuellen Situation sowieso.
Wie sieht denn für Sie eine Lösung für ein einzelnes Krankenhaus aus?
Ein Patentrezept habe ich nicht – dann wäre ich reich und berühmt. Spaß beiseite: Es braucht sicher einen guten Mix aus einzelnen Maßnahmen, die in ihrer Gesamtheit einer klaren langfristigen Strategie folgen. Ich bin fest überzeugt, dass politische Denkverbote abgeschafft und Kliniken intensiv an einem ausgewogenen Leistungsportfolio und einem exzellenten Versorgungsangebot arbeiten müssen. Hierfür lohnt ein Blick über den Tellerrand, ob gute Partnerschaften auf Augenhöhe erreichbar und damit Standortstärkungen und Wettbewerbsvorteile möglich sind.
Wettbewerbsmitentscheidend dürfte auch der jeweilige Digitalisierungsgrad eines Standorts sein. Hinzu kommen kluge und agile Entscheidungen mit schnellen Entscheidungswegen vor Ort, ständige Marktbeobachtung und die echte Bereitschaft, sich wechselnden Rahmenbedingungen anzupassen. Letzteres muss Teil der Unternehmenskultur werden. Für diese Ziele trete ich mit meiner Position kraftvoll ein, denn wem das alles nicht gelingt, wird es als Standort in Zukunft sehr, sehr schwer haben.
Wie sieht Ihre Strategie aus?
Hier möchte ich nicht so sehr ins Detail gehen. Nur so viel: Eine gute Strategie zu haben bedeutet, zu jedem Zeitpunkt mehrere Handlungsoptionen zu haben und diese optional ziehen zu können. Unser Ziel ist klar – wir wollen die medizinische Versorgung der Region mitgestalten, weiterentwickeln und unseren Patienten ein qualitativ hochwertiges Angebot machen. Damit ist im Prinzip alles gesagt.